
Startseite
· Malediven allgemein
· Kulinarisches
· Atolle
· Pflanzen
· Landtiere
· Meerestiere
· Teil 1
· Teil 2
· Teil 3
· Teil 4
· Teil 5
· Teil 6
· Teil 7
· Teil 8
· Ökosystem
Korallenriff
· Schnorchelreviere
· Literatur & Linktipps
· Datenschutzerklärung
Ökosystem Korallenriff
 Das,
was die Malediven zu einem der begehrtesten Reiseziele für Taucher
macht, ist vom Land aus lediglich zu erahnen. Die Farbe des Wassers
reicht in der Lagune von hellem Türkis bis zu dunklem Schwarzblau, wo
das offene Meer liegt. Dazwischen erstrecken sich Bereiche, die
dunkelblau sind und sich deutlich von den sie umgebenden helleren
Gebieten der Lagune abheben. An solchen Stellen sowie an den
Abbruchkanten um die Inseln herum befinden sich Korallenbänke. Sie sind
sehr artenreich und deshalb unter Wasser so etwas wie das Pendant zum
tropischen Regenwald an Land. Die Abbildung in diesem Absatz zeigt einen
solchen dunkleren Bereich mit Korallenbewuchs in der Lagune der
Ferieninsel Dhigufinolhu. Rund um die Insel beträgt die Wassertiefe
überall maximal etwa zwei Meter und der Boden der Lagune ist sandig. Der
vordere, dunkle Bereich ist nicht tiefer, sondern lediglich mit
Korallenstöcken bewachsen, deren wahre Farbenpracht man über Wasser zwar
nicht erkennen kann, die jedoch die helle Untergrundfarbe des Sandes
verdecken. Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu
Das,
was die Malediven zu einem der begehrtesten Reiseziele für Taucher
macht, ist vom Land aus lediglich zu erahnen. Die Farbe des Wassers
reicht in der Lagune von hellem Türkis bis zu dunklem Schwarzblau, wo
das offene Meer liegt. Dazwischen erstrecken sich Bereiche, die
dunkelblau sind und sich deutlich von den sie umgebenden helleren
Gebieten der Lagune abheben. An solchen Stellen sowie an den
Abbruchkanten um die Inseln herum befinden sich Korallenbänke. Sie sind
sehr artenreich und deshalb unter Wasser so etwas wie das Pendant zum
tropischen Regenwald an Land. Die Abbildung in diesem Absatz zeigt einen
solchen dunkleren Bereich mit Korallenbewuchs in der Lagune der
Ferieninsel Dhigufinolhu. Rund um die Insel beträgt die Wassertiefe
überall maximal etwa zwei Meter und der Boden der Lagune ist sandig. Der
vordere, dunkle Bereich ist nicht tiefer, sondern lediglich mit
Korallenstöcken bewachsen, deren wahre Farbenpracht man über Wasser zwar
nicht erkennen kann, die jedoch die helle Untergrundfarbe des Sandes
verdecken. Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu
Riffe, wie man sie rund um die Malediveninseln bestaunen kann, werden von Korallen aufgebaut. Solche riffbildenden Korallenarten können nur in warmen, lichtdurchfluteten Gewässern gedeihen, weshalb man sie ausschließlich in den Tropen findet. Oft werden Korallen irrtümlich für Gestein gehalten. In Wirklichkeit handelt es sich bei der harten Substanz jedoch um die Skelette winziger Tiere, der Korallenpolypen. Generation für Generation leben diese Tiere auf den Überresten (dem Kalkskelett) ihrer Vorgänger und sie errichten so in mühevoller Kleinarbeit die filigranen Gebilde, die man am Riff beobachten kann.
 Diese
diesen sogenannten Hartkorallen bestehen aus massivem Kalziumkarbonat.
Geweih- und Hirnkorallen sind Beispiele für Vertreter dieses
Korallentypus. Hartkorallen werden auch als Riffbildner bezeichnet, ihre
Wachstumsrate liegt je nach Art zwischen fünf bis 25 Millimeter pro
Jahr. Daneben gibt es Weichkorallen an den Riffen der Malediven. Wie es
ihr Name bereits vermuten lässt, sind sie von weicher Konsistenz und
erinnern in ihrer äußeren Erscheinung oft an Pflanzen oder Bäume. Zu
ihnen gehört unter anderem die Blasenkoralle. Im Unterschied zu den
riffbildenden Hartkorallen sind die Weichkorallen vergängliche Wesen,
die nicht zur dauerhaften Bildung eines Riffs beitragen. Zudem benötigen
sie weniger Licht als die Hartkorallen und leben daher auch in dunkleren
und kühleren Meeresregionen sowie in größerer Tiefe. Die Abbildung in
diesem Absatz zeigt einige Hartkorallen sowie einen jungen weiblichen
Dunkelkappen-Papageifisch (Scarus scaber, links) und einen
Dreifleck-Preußenfisch (Dascyllus trimaculatus).
Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu
Diese
diesen sogenannten Hartkorallen bestehen aus massivem Kalziumkarbonat.
Geweih- und Hirnkorallen sind Beispiele für Vertreter dieses
Korallentypus. Hartkorallen werden auch als Riffbildner bezeichnet, ihre
Wachstumsrate liegt je nach Art zwischen fünf bis 25 Millimeter pro
Jahr. Daneben gibt es Weichkorallen an den Riffen der Malediven. Wie es
ihr Name bereits vermuten lässt, sind sie von weicher Konsistenz und
erinnern in ihrer äußeren Erscheinung oft an Pflanzen oder Bäume. Zu
ihnen gehört unter anderem die Blasenkoralle. Im Unterschied zu den
riffbildenden Hartkorallen sind die Weichkorallen vergängliche Wesen,
die nicht zur dauerhaften Bildung eines Riffs beitragen. Zudem benötigen
sie weniger Licht als die Hartkorallen und leben daher auch in dunkleren
und kühleren Meeresregionen sowie in größerer Tiefe. Die Abbildung in
diesem Absatz zeigt einige Hartkorallen sowie einen jungen weiblichen
Dunkelkappen-Papageifisch (Scarus scaber, links) und einen
Dreifleck-Preußenfisch (Dascyllus trimaculatus).
Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu
Als Nahrung dient den Korallenpolypen das Zooplankton, zu dem unter anderem Krebslarven gehören. Nachts stülpen sich die Polypen aus ihrem Skelett und strecken Tentakel aus, um das im Wasser driftende Zooplankton zu fangen. Viele Hartkorallen haben spezielle Ernährungsgewohnheiten entwickelt. In den Skeletten der harten Korallen leben neben den Polypen einzellige Algen, die sogenannten Zooxanthellen. Diese Algen nutzen das in das flache Wasser einfallende Sonnenlicht zur Photosynthese und versorgen dadurch die Korallenpolypen mit bis zu 90 Prozent ihres Nahrungsbedarfs. Sie liefern beispielsweise Zucker und Stärke. Auf diese Weise ist es Hartkorallen überhaupt möglich, in Meeresgebieten zu leben, die arm an Zooplankton sind.
 Wo es Korallen gibt, siedeln sich Fische an. Die kleinsten von ihnen
leben zwischen den Korallenarmen und verstecken sich dort vor größeren
Fressfeinden, die man am Riff patrouillieren sehen kann. Einige
Fischarten haben sich darauf spezialisiert, Algen von den Korallen
abzuschaben. Darüber hinaus leben am Riff Korallenfresser wie die
Papageifische (siehe Foto rechts), die mit ihrem mächtigen Gebiss Stücke
aus Hartkorallen brechen, diese zermalmen und nach dem Verdauen der
Algen und Polypen feinen Sand ausscheiden, der an Land gespült
idyllische Sandstrände bildet. Viele der am und vom Riff lebenden
Fischarten stehen auf dem Speiseplan größerer Raubfische wie Barrakudas.
Diese wiederum ziehen Haie an, die man in den tropischen Meeren
gelegentlich als Schnorchler und Taucher zu Gesicht bekommt. So hängen
Großfische indirekt von Algen und Korallenpolypen ab. Am Hausriff von
Dhigufinolhu, meinem Feriendomizil im Süd-Malé-Atoll im Jahr 1998, habe
ich die typischen
Riffbewohner beobachtet. Dabei haben mich die vielen Papageifische
mit ihren starken "Schnäbeln" besonders beeindruckt. Da Wasser ein guter Schallleiter ist,
habe ich das laute Knirschen beim Biss in eine Koralle und das
anschließende Kauen der Papageifische deutlich vernehmen können.
Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu
Wo es Korallen gibt, siedeln sich Fische an. Die kleinsten von ihnen
leben zwischen den Korallenarmen und verstecken sich dort vor größeren
Fressfeinden, die man am Riff patrouillieren sehen kann. Einige
Fischarten haben sich darauf spezialisiert, Algen von den Korallen
abzuschaben. Darüber hinaus leben am Riff Korallenfresser wie die
Papageifische (siehe Foto rechts), die mit ihrem mächtigen Gebiss Stücke
aus Hartkorallen brechen, diese zermalmen und nach dem Verdauen der
Algen und Polypen feinen Sand ausscheiden, der an Land gespült
idyllische Sandstrände bildet. Viele der am und vom Riff lebenden
Fischarten stehen auf dem Speiseplan größerer Raubfische wie Barrakudas.
Diese wiederum ziehen Haie an, die man in den tropischen Meeren
gelegentlich als Schnorchler und Taucher zu Gesicht bekommt. So hängen
Großfische indirekt von Algen und Korallenpolypen ab. Am Hausriff von
Dhigufinolhu, meinem Feriendomizil im Süd-Malé-Atoll im Jahr 1998, habe
ich die typischen
Riffbewohner beobachtet. Dabei haben mich die vielen Papageifische
mit ihren starken "Schnäbeln" besonders beeindruckt. Da Wasser ein guter Schallleiter ist,
habe ich das laute Knirschen beim Biss in eine Koralle und das
anschließende Kauen der Papageifische deutlich vernehmen können.
Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu
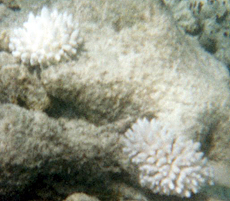 Die
Korallen auf den Malediven sind bei meinem Besuch im Juni 1998 zum Teil
in einem erschreckend schlechten Zustand gewesen. Etliche Korallenblöcke
nahe der Uferzone sind zerbrochen gewesen, weil Touristen sich mit den
Schwimmflossen zuvor achtlos auf sie gestellt hatten. In den tieferen,
gerade noch sichtbaren Bereichen der Riffkante hat man alte Ölfässer,
Müllbeutel sowie verlorene Anker erkennen können. Auf den Malediven ist
es bedauerlicherweise lange Zeit üblich gewesen, den Zivilisationsmüll
einfach im Meer zu versenken. In dieser Hinsicht hat zwar längst ein
Umdenken stattgefunden, was jedoch einen großen Teil der in den
Gewässern um die Malediven heimischen Korallenwelt nicht vor einer
anderen Gefahr bewahren kann: der Korallenbleiche, siehe Abbildung in
diesem Absatz. Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu
Die
Korallen auf den Malediven sind bei meinem Besuch im Juni 1998 zum Teil
in einem erschreckend schlechten Zustand gewesen. Etliche Korallenblöcke
nahe der Uferzone sind zerbrochen gewesen, weil Touristen sich mit den
Schwimmflossen zuvor achtlos auf sie gestellt hatten. In den tieferen,
gerade noch sichtbaren Bereichen der Riffkante hat man alte Ölfässer,
Müllbeutel sowie verlorene Anker erkennen können. Auf den Malediven ist
es bedauerlicherweise lange Zeit üblich gewesen, den Zivilisationsmüll
einfach im Meer zu versenken. In dieser Hinsicht hat zwar längst ein
Umdenken stattgefunden, was jedoch einen großen Teil der in den
Gewässern um die Malediven heimischen Korallenwelt nicht vor einer
anderen Gefahr bewahren kann: der Korallenbleiche, siehe Abbildung in
diesem Absatz. Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu
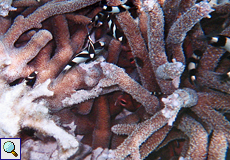 Als
das Klimaphänomen El Niño 1998 in Erscheinung getreten ist, hat es sich
mit bis dahin nie beobachteter Intensität ereignet. Die zerstörerischen
Auswirkungen des wahrscheinlich durch den Einfluss des Menschen
verstärkten natürlichen Klimaphänomens vor der Südamerikanischen
Westküste sind selbst im fernen Indischen Ozean zu spüren gewesen. Das
Oberflächenwasser hat sich stark auf geheizt und Wasserströmungen haben
ihre Fließrichtung ein wenig geändert. Dadurch ist das Wasser an den
Riffen der Malediven durchschnittlich ein Grad wärmer geworden. Die
Abbildung in diesem Absatz zeigt einen Korallenstock mit
Dreibinden-Preußenfischen (Dascyllus aruanus).
Foto: Juli 2002, Sun Island
Als
das Klimaphänomen El Niño 1998 in Erscheinung getreten ist, hat es sich
mit bis dahin nie beobachteter Intensität ereignet. Die zerstörerischen
Auswirkungen des wahrscheinlich durch den Einfluss des Menschen
verstärkten natürlichen Klimaphänomens vor der Südamerikanischen
Westküste sind selbst im fernen Indischen Ozean zu spüren gewesen. Das
Oberflächenwasser hat sich stark auf geheizt und Wasserströmungen haben
ihre Fließrichtung ein wenig geändert. Dadurch ist das Wasser an den
Riffen der Malediven durchschnittlich ein Grad wärmer geworden. Die
Abbildung in diesem Absatz zeigt einen Korallenstock mit
Dreibinden-Preußenfischen (Dascyllus aruanus).
Foto: Juli 2002, Sun Island
 Die
in den Korallen lebenden Algen haben aufgrund der höheren
Außentemperatur aggressive Moleküle produziert, die den Korallenpolypen
geschadet haben. Deshalb haben sie die Polypen abgestoßen. Daraufhin
sind viele Korallen an Nahrungsmangel gestorben. Die Skelette der
Korallen verlieren durch einen solchen Prozess im weiteren Verlauf ihre
Farbe und werden weiß - daher rührt der Name der Korallenbleiche. In den
geisterhaft weißen Korallenriffen verschwinden mit der Zeit einige
Fische, weil ihre Nahrungsgrundlage nicht mehr existiert. Dies ist im
Jahr 1998 auch auf den Malediven geschehen. Zur großen Verwunderung der
Forscher sind die meisten Fischarten jedoch in der Nähe ihrer ehemaligen
Nahrungsquellen geblieben und sie haben sich innerhalb kürzester Zeit
nahrhafte Alternativen erschlossen, indem sie beispielsweise die Algen
gefressen haben, die sich rasch auf den abgestorbenen Korallen gebildet
hatten. Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu
Die
in den Korallen lebenden Algen haben aufgrund der höheren
Außentemperatur aggressive Moleküle produziert, die den Korallenpolypen
geschadet haben. Deshalb haben sie die Polypen abgestoßen. Daraufhin
sind viele Korallen an Nahrungsmangel gestorben. Die Skelette der
Korallen verlieren durch einen solchen Prozess im weiteren Verlauf ihre
Farbe und werden weiß - daher rührt der Name der Korallenbleiche. In den
geisterhaft weißen Korallenriffen verschwinden mit der Zeit einige
Fische, weil ihre Nahrungsgrundlage nicht mehr existiert. Dies ist im
Jahr 1998 auch auf den Malediven geschehen. Zur großen Verwunderung der
Forscher sind die meisten Fischarten jedoch in der Nähe ihrer ehemaligen
Nahrungsquellen geblieben und sie haben sich innerhalb kürzester Zeit
nahrhafte Alternativen erschlossen, indem sie beispielsweise die Algen
gefressen haben, die sich rasch auf den abgestorbenen Korallen gebildet
hatten. Foto: Juni 1998, Dhigufinolhu
 Kurze Zeit später haben sich die Korallenriffe der Malediven ein wenig
regeneriert. Dies ist schneller und umfangreicher geschehen, als die
Wissenschaft dies für möglich gehalten hätte. Die Selbstheilungskräfte
des Ökosystems Korallenriff scheinen enorm groß zu sein. Trotzdem wäre
es leichtsinnig, diese Kräfte zu sehr zu strapazieren, indem man die
Riffe in Zukunft noch stärker belastet. Noch ein derart starker El Niño
würde vermutlich einen Großteil der Korallen für immer töten.
Foto: Juli 2002, Sun Island
Kurze Zeit später haben sich die Korallenriffe der Malediven ein wenig
regeneriert. Dies ist schneller und umfangreicher geschehen, als die
Wissenschaft dies für möglich gehalten hätte. Die Selbstheilungskräfte
des Ökosystems Korallenriff scheinen enorm groß zu sein. Trotzdem wäre
es leichtsinnig, diese Kräfte zu sehr zu strapazieren, indem man die
Riffe in Zukunft noch stärker belastet. Noch ein derart starker El Niño
würde vermutlich einen Großteil der Korallen für immer töten.
Foto: Juli 2002, Sun Island